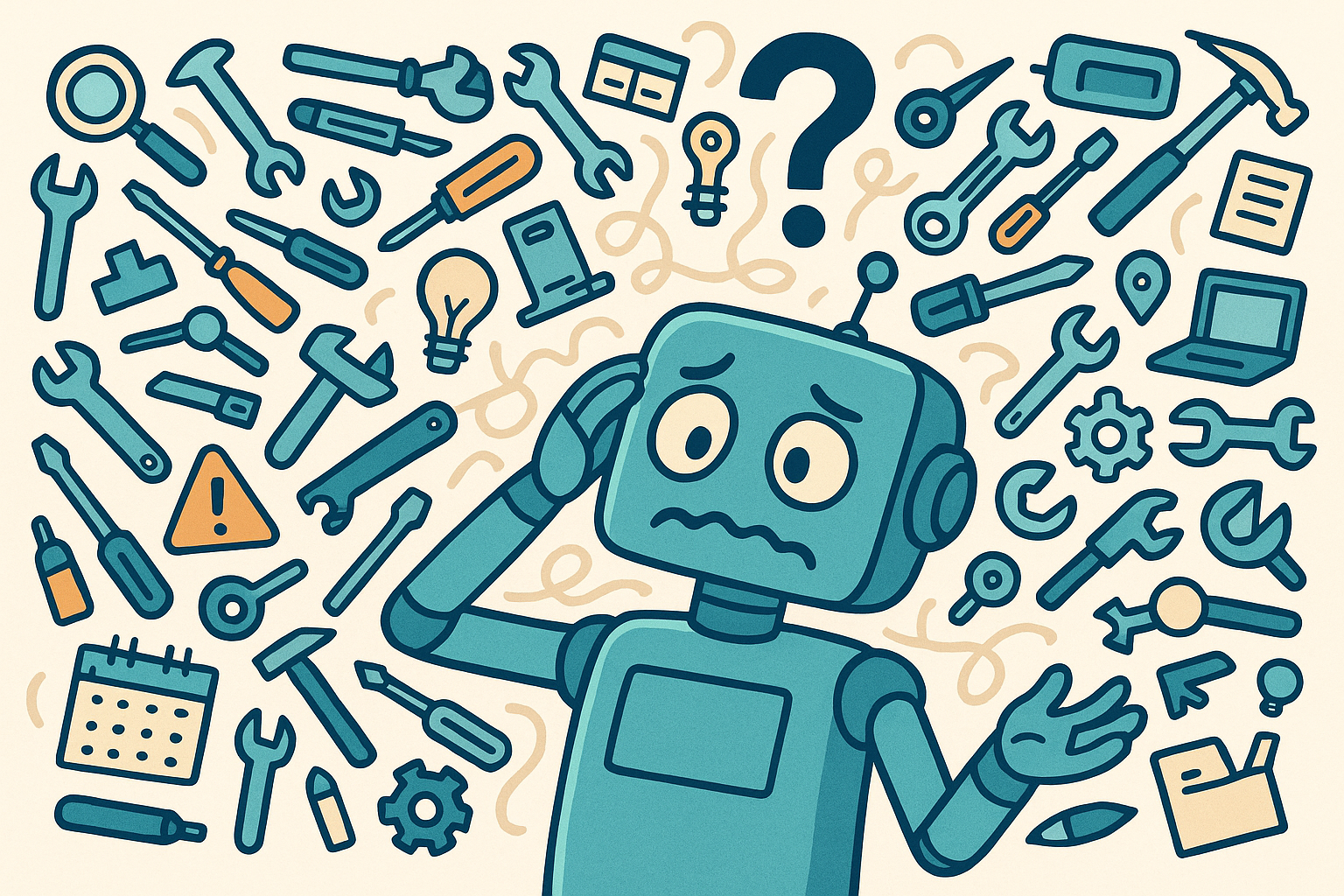Psychologische Sicherheit ist ein Konzept, das von der Harvard-Professorin Amy Edmondson geprägt wurde. Es beschreibt ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeitende sicher fühlen, ihre Meinungen, Bedenken und auch Fehler offen zu äußern – ohne Angst vor negativen Konsequenzen.
Edmondson hat dieses Konzept in ihrem Buch “Die angstfreie Organisation” anhand von besonders schwerwiegenden Vorfällen veranschaulicht: Flugzeugabstürze, ärztliche Behandlungsfehler und der VW-Dieselskandal. Bei einer so dramatischen Perspektive fiel es mir anfangs schwer, die Relevanz für ein kleines IT-Beratungsunternehmen wie unseres zu erkennen.
Doch nach einer intensiveren Beschäftigung mit diesem Thema habe ich schließlich die Bedeutung von psychologischer Sicherheit auch in unserem Kontext greifen können. Und ich halte meine Erkenntnisse für wertvoll genug, um sie zu teilen.
Agile Methoden wie Scrum und Kanban erfordern weit mehr als nur formale Strukturen und Prozesse. Sie setzen ein grundlegendes Mindset voraus, das von den agilen Werten geprägt ist – allen voran Respekt, Vertrauen und Mut. Ohne diese Werte bleiben agile Methoden eine leere Hülle: Meetings wie Dailys oder Retrospektiven sind ineffektiv, wenn die Teilnehmenden nicht offen über Probleme und Verbesserungspotenziale sprechen können.
Psychologische Sicherheit bildet daher den Nährboden, auf dem Feedback und Lernprozesse gedeihen. Erst durch diese entsteht die kontinuierliche Verbesserung, die das Herzstück der Agilität ausmacht. Ohne psychologische Sicherheit riskieren wir jedoch, lediglich iterativ Probleme auszubauen.
Ein Verständnis für die Auswirkungen fehlender oder vorhandener psychologischer Sicherheit lässt sich durch klassische psychologische Modelle gewinnen – zum Beispiel durch Maslows Bedürfnishierarchie. Dieses Modell beschreibt, dass Menschen erst dann höhere Ziele anstreben können, wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind. Die Bedürfnisse folgen dabei einer Rangordnung: Solange Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst oder Sauerstoff nicht gedeckt sind, treibt uns der Mangel in diesen Bereichen zum Handeln und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Erfüllung dieser Bedürfnisse. Erst wenn die Bedürfnisse der vorangegangenen Ebene gesichert sind, können wir uns weiterentwickeln und höhere Bedürfnisse werden relevant – wir werden uns beispielsweise keinen Luxusurlaub leisten, solange wir Hunger leiden.
Ein ähnliches Prinzip beschreibt Patrick Lencioni in seinem Modell der „5 Dysfunktionen eines Teams“. In der Teamarbeit entspricht psychologische Sicherheit hier der untersten Stufe in Maslows Pyramide: der Basis für Zusammenarbeit, dem Vertrauen. Nur wenn Vertrauen im Team vorhanden ist, sind wir bereit, Konflikte offen anzusprechen und zu lösen. Und nur durch das Auseinandersetzen mit Konflikten können wir uns wirklich auf Entscheidungen und Ideen committen. Commitment führt dann dazu, dass wir Verantwortung übernehmen, und nur mit Verantwortung bündeln wir schließlich unsere Kräfte für gemeinsame Ziele.
Auch in Lencionis Modell gilt: Jede Stufe baut auf der vorhergehenden auf. Alles beginnt mit Vertrauen – oder, in unserem Kontext, mit psychologischer Sicherheit. Tatsächlich können wir das „Vertrauen“ in Lencionis Modell hier als Synonym für psychologische Sicherheit verstehen. So wird klar: Alles beginnt mit psychologischer Sicherheit.
Merkmale und Prozesse psychologisch sicherer Umgebungen
Psychologische Sicherheit ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann als gegeben ansieht. Sie ist vielmehr ein Prozess, der beständig gepflegt und geschützt werden muss – wie eine Pflanze, die regelmäßig Wasser und Licht braucht, um zu gedeihen. So wie Pflanzen aufblühen können, so können auch Menschen aufblühen, wenn sie sich in ihrer Umgebung psychologisch sicher fühlen.

Amy Edmondson beschreibt es so: In einem Umfeld, das psychologische Sicherheit bietet, sind Menschen bereit und fähig, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Sie bringen ihre Ideen, Meinungen und Bedenken offen ein, gestehen Fehler ein und fürchten dabei weder Beschämung noch Sanktionen. Sie trauen sich authentisch zu sein und suchen auch in Konfliktsituationen den Dialog.
Psychologische Sicherheit existiert auf der zwischenmenschlichen Ebene – in Teams, Gremien oder Meetings. Ein ganzes Unternehmen kann nicht „psychologisch sicher“ sein, aber alle Institutionen und Beziehungen darin schon.
Diese Art von Sicherheit ist kein Selbstzweck, um die Welt ein bisschen schöner zu machen. „Das Leben ist kein Wunschkonzert,“ wie es so treffend heißt. Aus ökonomischer Sicht ist psychologische Sicherheit äußerst nützlich: Sie reduziert Reibungsverluste, die etwa durch verdeckte Konflikte entstehen könnten. Psychologische Sicherheit löst den „Sand aus dem Getriebe“ und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Sie ermöglicht es aus Fehlern zu lernen und auf Dauer weniger – oder zumindest andere, neue Fehler – zu machen.
Darüber hinaus schützt sie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und wirkt präventiv gegen Burnout. Sie reduziert den emotionalen Druck, der auf jedem von uns lastet. Auch gesundheitliche Ausfälle und hohe Fluktuation sind teuer.
Wodurch wird Psychologische Sicherheit zerstört?
Es gibt zahlreiche Verhaltensweisen, die psychologische Sicherheit untergraben können, beispielsweise:
- ~Abwertende nonverbale Kommunikation: Augenrollen, schweres Atmen, Seufzen, wütender Blick, verschränkte Arme, zurückgelehntes Sitzen – und dabei nichts zu sagen
- ~Kritik nur in der Gruppe oder hinter dem Rücken, aber nie im Vier-Augen-Gespräch zu äußern
- ~Abwertende Aussagen: „Daran hast du wohl nicht gedacht?“, „Ist das nicht eigentlich deine Aufgabe?“, „Das ist ja wohl klar – siehst du das nicht?“, oder „Hast du dir das nicht denken können?“
- ~Sarkasmus oder Ironie: Bemerkungen wie „Ach, und dann macht einfach jeder, was er will?“ oder „So so, wir dokumentieren künftig also alles, bis wir nichts mehr wiederfinden.“
- ~Schuldzuweisungen: Anderen die Schuld geben oder gezielt nach Schuldigen suchen
- ~Diskussionen dominieren: Darauf bestehen, in Diskussionen zu „gewinnen“ oder andere um jeden Preis von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen
- ~Persönliche Empfindlichkeit: Sachliche Aussagen anderer als persönlichen Angriff zu interpretieren

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen, und vermutlich erkennt sich jeder in mindestens einem dieser Verhaltensmuster wieder. Oft geschehen solche Dinge unabsichtlich – wir alle sind keine Engel oder Heiligen.
Wer „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari gelesen hat, kennt vielleicht die These, dass Klatsch und Tratsch in der Evolution eine entscheidende Rolle gespielt haben: Sie ermöglichten uns überhaupt erst komplexere Formen der Zusammenarbeit.
Hier geht es jedoch nicht darum, dass sich jemand schämt oder selbst abwertet, weil er sich schon einmal so wie oben aufgeführt verhalten hat. Vielmehr geht es darum, dass sich jeder, der sich hier angesprochen fühlt, diese Verhaltensmuster bewusst macht und sich immer wieder neu entscheiden kann, wie er künftig damit umgeht.
Diese Verhaltensweisen sind zutiefst menschlich, doch langfristig hinterlassen sie Spuren im Teamklima – Spuren, die wir vermeiden oder zumindest reflektieren sollten.
Warum?
„Ohne {psychologische Sicherheit} ist alles doof.“
Stell dir vor, du sitzt in einem Meeting und fragst: „Hat jemand eine Idee?“, und niemand antwortet. Psychologisch unsichere Umgebungen fördern genau solche Verhaltensmuster: Schweigen in Meetings, Mangel an ehrlichem Feedback und fehlende Offenheit. Es entsteht eine Arbeitskultur, in der Konflikte als „Elefant im Raum“ bestehen bleiben, das Potenzial für Innovation hemmen und das Teamklima langsam, aber sicher vergiften.
In solchen Teams fühlen sich die Mitglieder unwohl, ihre Meinungen offen zu äußern. Selbst bei Unklarheiten wagt man es oft nicht nachzufragen. Es wird selten ehrlich über die Herausforderungen gesprochen, die einen beschäftigen, und Fehler werden eher vertuscht als offen angesprochen. Verantwortung wird zunehmend vermieden, und keiner fühlt sich wirklich verstanden. Ein vages Misstrauen macht sich breit, sowohl gegenüber anderen als auch – subjektiv empfunden – sich selbst gegenüber. Diese Umgebung führt oft zu verdeckten Formen des Widerstands.
Passive Aggressivität ist eine solche subtile Form des Widerstands und eine Strategie, um Frustration ohne offene Konfrontation auszudrücken. Sie hat viele Erscheinungsformen: Sarkasmus und zweideutige Aussagen, Rückzug, Ausreden und Lügen, Lästerei sowie passives Verweigern durch Verzögerungen, Blockieren, ineffizientes Arbeiten, das „Vergessen“ von Aufgaben oder das Ablehnen von Veränderungen.
Fakt ist: Konfliktvermeidung führt unweigerlich zu tiefergehenden Konflikten, die Vertrauen und Offenheit innerhalb des Teams weiter schwächen. Es ist eine Abwärtsspirale: Verletzungen der psychologischen Sicherheit führen zu Mechanismen, die diese Verletzungen weiter verstärken.
Oft ist dieses Verhalten jedoch nicht vorsätzlich passiv-aggressiv, sondern eine erlernte psychologische Überlebensstrategie. Diese haben wir uns schon früh im Leben angeeignet – in der gleichen Zeit, in der wir gelernt haben, zwischenmenschliche Konflikte zu fürchten und uns bestimmten Anforderungen nicht entziehen zu können. Eine bewusst gepflegte, psychologisch sichere Kultur profitiert daher von einem tieferen Verständnis für individuelle Prägungen und gesellschaftliche Einflüsse.
Die Rolle von Scham
Wenn uns von außen (vermeintlich) signalisiert wird, dass wir gegen soziale oder moralische Normen verstoßen haben, dass unsere Integrität angezweifelt wird, dass wir inkompetent wirken oder „nicht richtig“ sind – sei es durch Fehler oder Schwächen – reagieren wir oft mit Scham. Scham ist eine der tiefsten und mächtigsten menschlichen Emotionen.

Während Schuld sich auf eine konkrete Handlung bezieht („Ich habe etwas falsch gemacht“), greift Scham das Selbstwertgefühl an und betrifft uns als ganze Person („Ich bin falsch“). Sie berührt unsere tiefste Verletzlichkeit und kann uns nachhaltig verunsichern. Weil Scham ein schmerzhaftes Gefühl ist, das wir um jeden Preis vermeiden wollen, haben Institutionen und Gesellschaften dieses Gefühl in der Vergangenheit gezielt als Werkzeug zur Kontrolle und Verhaltenssteuerung genutzt. Schwarze Pädagogik und die Lehren des Christentums machten Scham zu einem Mittel der „Disziplinierung“, um Eigenwilligkeit zu unterdrücken und Konformität zu fördern. Diese Konditionierung hinterließ tiefe psychologische Spuren und beeinflusst unsere Kultur bis heute.
Natürlicherweise tendieren wir dazu, unsere Schwächen und Fehler zu verstecken. Wir wollen sie weder unseren Kollegen noch unseren Freunden oder Partnern zeigen – manche Fehler und Schwächen verbergen wir sogar vor uns selbst. Auch das Erheben der eigenen Stimme fällt vielen Menschen schwer, was ebenfalls auf die starke Wirkkraft der Scham zurückzuführen ist. In einer Gruppe etwas zu äußern bedeutet, dass man alle Blicke auf sich zieht. Ein persönliches Risiko, das sich noch steigert, wenn es um Kritik oder kontroverse Meinungen geht. Dieses Risiko wird von jedem Menschen unterschiedlich stark empfunden – manche können sich schlicht nicht überwinden zu vertrauen.
Unsere Fähigkeit, anderen zu vertrauen und uns in Gruppen sicher zu fühlen, ist stark von unseren individuellen Erfahrungen geprägt. Diese Erfahrungen sind wie Filter, durch die wir unsere Umwelt wahrnehmen. Sie beeinflussen uns in wesentlichen Fragen:
- ~Halte ich die Welt für grundsätzlich freundlich oder gefährlich?
- ~Bin ich ständig besorgt darüber, was andere von mir denken?
- ~Glaube ich, dass andere mich für unfähig, zu laut oder langweilig halten?
- ~Gehe ich mit einer grundsätzlich positiven Erwartung in zwischenmenschliche Begegnungen?
Wer in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit Konfliktgesprächen oder Kritik gemacht hat, wird oft Schwierigkeiten haben, Vertrauen in einem Team aufzubauen, selbst wenn das Umfeld objektiv sicher ist.

Es kann also nicht nur darum gehen, dass die Außenwelt sicher genug ist – es geht auch um die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeit zu vertrauen.
Jeder von uns hat also zwei Stellhebel:
Wir können aktiv an einer psychologisch sicheren Außenwelt mitwirken und gleichzeitig die Fesseln vergangener Erfahrungen in unserer Innenwelt lockern.
Was genau können wir tun?
Psychologische Sicherheit kann nicht von einer Person allein geschaffen oder angeordnet werden. Sie ist eine gemeinsame Verantwortung, die jedes Teammitglied trägt.
+ Feedbackkultur: Wertschätzende Aufrichtigkeit als Grundlage
Ein zentraler Bestandteil psychologischer Sicherheit ist die Fähigkeit, konstruktives Feedback zu geben und zu empfangen – sowohl positives als auch negatives. Konstruktives Feedback ist offen und unverblümt, aber auch respektvoll und darauf bedacht, alle Beteiligten voranzubringen. Kim Scott beschreibt dies als „wertschätzende Aufrichtigkeit“: ehrliches Feedback, das menschlich und zugewandt bleibt.
Eine gesunde Feedbackkultur erfordert, dass Kritik erbeten und angenommen werden kann, ohne sie persönlich zu nehmen. Sie verlangt Offenheit für eigenes Fehlverhalten und den Willen, daraus zu lernen.
+ Fehlerkultur: Realistischer Umgang und Selbstmitgefühl
Ein weiterer wichtiger Aspekt psychologischer Sicherheit ist der konstruktive Umgang mit Fehlern, insbesondere den eigenen. Fehler sind oft mit Scham und Selbstabwertung verbunden, doch für eine gesunde Fehlerkultur müssen wir lernen, diese Gefühle zu verstehen und in Selbstmitgefühl umzuwandeln. Dies hilft, unsere Fehlbarkeit als normal zu akzeptieren. Erst recht, wenn wir bereit sind, sie uns gegenseitig offen zu zeigen.
Wer sich bei Fehlern nur selbst verurteilt, kann anderen kaum glaubwürdig vermitteln, dass ihre Fehler verzeihlich sind.
Zu einer guten Fehlerkultur gehört auch, sich für Fehler zu entschuldigen. Angenommen, wir sind in einem Meeting jemanden ungeduldig angegangen. Wenn wir das Vertrauen des Gegenübers verletzt haben, erfordert eine konstruktive Fehlerkultur, die Verantwortung dafür zu übernehmen, sich selbst diesen Fehler einzugestehen und sich aufrichtig zu entschuldigen. Eine simple und ehrliche Aussage wie „Was ich gesagt habe, war verletzend. Es tut mir leid“, kann der erste Schritt zur Heilung sein. Doch Vertrauen ist oft sensibel, und es ist nicht immer sofort alles wieder gut. Manchmal braucht es Geduld und ein echtes Verständnis für die Gefühle des anderen, besonders wenn die Verletzung tiefer sitzt.
Was aber, wenn das Vertrauen uns gegenüber verletzt wurde? Auch hier spielt eine gute Fehlerkultur eine wichtige Rolle: Es bedeutet, den Schmerz anzuerkennen, ihn zuzulassen und zu verarbeiten – nicht wegzuschieben oder abzutun. Darauf aufbauen kann die notwendige Bereitschaft und der ehrliche Wunsch, die Beziehung wieder aufzubauen und erneut vertrauen zu wollen. Das beinhaltet auch die Fähigkeit, eine Entschuldigung anzunehmen, ohne nachtragend zu bleiben – es muss schließlich irgendwann wieder gut sein.
+ Dennoch kann es nicht nur darum gehen, dass die äußeren Umstände sicherer werden. Es liegt genauso an uns selbst, unser eigenes Misstrauen und unsere Kränkbarkeit zu hinterfragen:
- ~Kann ich den anderen klar und realistisch sehen?
- ~Bin ich vielleicht zu misstrauisch oder umgekehrt zu naiv?
- ~Kann ich mein eigenes Vertrauen und meine Offenheit realistisch einschätzen?
- ~Bin ich bereit, Kritik anzuhören, ohne mich sofort angegriffen zu fühlen?
- ~Traue ich mich, meine Meinung zu äußern, auch wenn sie auf Widerstand stoßen könnte?
- ~Fühle ich mich als gleichwertiges und wertvolles Mitglied des Teams?
Letztlich ist psychologische Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung und verlangt den Mut, sowohl sich selbst als auch anderen mit Vertrauen zu begegnen.
+ Eine Übung, die ich euch empfehle, wann immer ihr euch unsicher fühlt, was andere über euch denken, ist ein sogenannter „Reality-Check“.
Wenn ihr euch in einer Situation unsicher fühlt oder Scham empfindet, könnt ihr beispielsweise sagen:
„Als ich neulich XYZ gesagt habe, hatte ich das Gefühl, dass du negativ reagiert hast. Findest du mich vielleicht unsympathisch?“
Oft wird die Antwort dann überraschenderweise „nein“ sein, und es wird klar, dass du etwas auf dich bezogen hast, was dr nicht galt. Unsere Wahrnehmung kann manchmal trügerisch sein.
+ Wir haben über die Bedeutung einer konstruktiven Fehlerkultur gesprochen, doch auch eine Erfolgskultur ist essenziell.
Diese sollte nicht nur das Endergebnis, sondern ebenso die Bemühungen und den gesamten Prozess wertschätzen.
+ Ein weiterer „Evergreen“, den wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollten, ist die Gewaltfreie Kommunikation.
Auch wenn sie im Alltag nicht immer wortwörtlich umsetzbar ist, bietet sie zumindest ein hilfreiches Werkzeug zur Selbstreflexion.
+ Damit ein bewusster Umgang miteinander möglich wird, müssen wir uns aktiv Räume schaffen, in denen wir innehalten und reflektieren können.
Eine Entschleunigung im Alltag hilft uns, regelmäßig zu fragen: Was passiert hier gerade? Wie gehe ich mit anderen um? Wie gehen andere mit mir um? Und wie gehe ich mit mir selbst um?
+ Besonders wichtig ist: Üben, üben, üben.
Eine gesunde Kultur der psychologischen Sicherheit entsteht nicht von heute auf morgen.
+ Auch auf Unternehmensebene können wir Maßnahmen zur Förderung psychologischer Sicherheit ergreifen.
Dazu gehören klare Rollen und Erwartungen, eine geeignete Moderation in Meetings, gezielte Entwicklungsangebote und individuelles Coaching. Diese Rahmenbedingungen helfen dabei, eine psychologisch sichere Umgebung zu schaffen, in der alle aufblühen können.
Die Rolle der Führungskräfte
Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle dabei, psychologische Sicherheit zu fördern oder zu untergraben. Dabei denken wir oft an Personen in hierarchischen Positionen, aber Macht kann auch durch andere Rollen oder systemische Kontexte entstehen — etwa bei Meeting-Moderatoren, langjährigen Mitarbeitenden oder solchen mit speziellem Fachwissen.
Ob wir es wollen oder nicht, Macht haftet oft an uns. Verantwortungsbewusstes Handeln bedeutet, sich dieser Rolle bewusst zu sein. In jeder Position mit Macht sind wir Leitfiguren und prägen mit unserem Verhalten die Kultur der Gruppe. Wir setzen den Maßstab: Unser Verhalten kann ein gesundes oder ein toxisches Umfeld schaffen.

Führungskräfte sind zwar nicht automatisch besser im Zwischenmenschlichen und können sich ebenso psychologisch unsicher fühlen. Doch durch Mut und Aufmerksamkeit — etwa durch das Eingestehen eigener Fehler, das Einfordern und Annehmen von Feedback oder das aktive Ansprechen von Konflikten — können sie eine Kultur des Respekts und Vertrauens vorleben.
Ein einzelnes unbedachtes Verhalten eines Chefs im Meeting, wie das Bloßstellen eines Mitarbeiters, kann viele positive Interaktionen die Mitarbeitende vorher untereinander hatten zunichtemachen.
Psychologisch unsichere Umgebungen sind die Regel
Psychologische Sicherheit aufzubauen bedeutet, umfassende, komplexe, zwischenmenschliche Fähigkeiten zu entwickeln, die in unserer Gesellschaft oft vernachlässigt werden. In einer Welt, in der uns psychologische Unsicherheit meist als Normalität begegnet, erfordert das Schaffen von Sicherheit ein bewusstes Handeln – oft gegen den gesellschaftlichen Strom.
Die tief sitzende Angst vor Beschämung und Strafe wurzelt in gesellschaftlichen und psychologischen Prägungen, die nur mit Zeit, Anstrengung und kontinuierlicher Praxis überwunden werden können.

Ich hoffe ich konnte zum Ausdruck bringen, dass es entscheidend ist, dass wir nicht nur im Außen nach Ursachen und Maßnahmen suchen, sondern auch unsere eigene Unsicherheit hinterfragen und verstehen lernen.
Und ich möchte euch zum Abschluss darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema ebenso außerhalb der Arbeitswelt wichtig ist. Von unserer Auseinandersetzung mit unserer eigenen Unsicherheit und unserem Verhalten profitieren alle, die uns nahe stehen, vor allem unsere Partner*innen und Kinder.
Daher denke ich, es lohnt sich, diese Anstrengung auf uns zu nehmen. – So oder so.